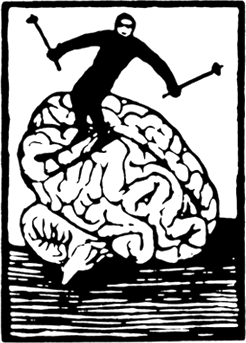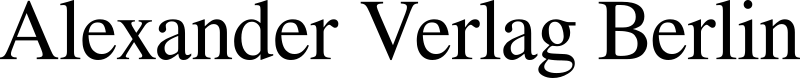Programm
Interview mit Christian Petzold
»Du musst eine Erzählung für dein Zeug haben.« oder: »Boateng würde das bestimmt auch machen.«
Interview mit Christian Petzold für das Buch Proben für Film
von Jan Krüger, Januar 2016 (unbearbeitete Fassung)
JK: Du hast mal in einem Interview gesagt, du hättest deine Zeit auf der Filmhochschule dffb überwiegend mit Filme schauen verbracht. Wo hast du die Arbeit mit Schauspielern gelernt?
CP: Ich hab viele Jahre als Beleuchter an der Schaubühne gearbeitet, unter Dieter Sturm, einem genialen Dramaturgen. Der hat im Grunde für jedes Stück einen Metaphernraum gebaut: »Darum geht‘s im Stück, das sind die Filme, die wir uns dafür anschauen, das sind die Fotos, das ist die Literatur, die ihr zu lesen habt...« Da habe ich mitbekommen, dass das der größte Teil der Proben ist – zu wissen, in welcher metaphorischen Blase oder Fiktion man sich befindet. Das hat Sinn gemacht für mich, und das konnte ich auch selbst gut hinkriegen.
Pilotinnen und Beischlafdiebin waren dann die zwei Filme, wo ich von zwei Schauspielerinnen so ziemlich alles gelernt habe. Bei Pilotinnen war es Eleonore Weisgerber, die mir alles beigebracht hat. Sie kommt selbst vom Theater, ist dann aber nach Paris gegangen und hat bei Chabrol gespielt. Dort hat sie eine andere Welt kennengelernt – eine andere Art und Weise der Körperlichkeit, und des Sprechens. Dieses französische ›weg-sprechen‹. Das hat sie mir beigebracht, indem wir uns das Drehbuch vorgenommen haben, und dann haben wir einfach Punkte durch Kommas ausgetauscht. Oder ein Verb weggelassen. Oder vereinfacht. Sie hat gesagt, schlechte Schauspieler wehren sich, wenn man ihnen Texte streicht, gute Schauspieler lieben das – wenn es aus den Proben heraus geschieht. Ist ja auch ein merkwürdiger Effekt – streichst du Dialogzeilen, wird die Szene länger...
Bei Beischlafdiebin war es dann Constanze Engelbrecht – die war auch in Paris gewesen, hat auch bei Chabrol gespielt. Die beiden brachten einfach eine andere Erfahrung mit.
So etwas lernt man nicht an der Filmhochschule?
Die Filmakademien sind eine besondere Sache. Die Aufnahmekriterien sind sehr hart, von 800 Bewerbern kommen 17 durch, da hast du dann Leute unter absolutem Hybris-Verdacht. Und die verbreiten Angst! Weil sie selbst ihre eigene Angst verstecken wollen – hinter Großmäuligkeit und Empathielosigkeit. Da fehlt dann das wichtigste – und es tut mir leid, aber die Schauspieler sind nun mal das wichtigste. Über alles andere kann man diskutieren. Aber das mit den Schauspielern – die geben etwas, das zu beschützen ist.
Wie ging es dann bei dir weiter?
Ich hatte bei Die Innere Sicherheit zum ersten Mal alle Voraussetzungen, gut vorzubereiten – auch weil die Finanzierung so lange gedauert hat... Wir haben uns eine Woche lang in Berlin in einer Wohnung eingeschlossen: Barbara Auer, Julia Hummer und Richy Müller, und haben in der Zeit nicht in dem Sinne geprobt, sondern kalt gelesen – und Filme geguckt. Da haben wir Near Dark gesehen von Kathryn Bigelow, Exilfilme, und haben uns kennengelernt. Vor allen Dingen auch die Schauspieler untereinander. Nach fünf Tagen war ich nicht mehr der wichtigste Mensch...
War das nicht erst mal schwierig, so aufeinander zu sitzen? Das ist ja auch ein Druckkessel...
Na klar. Die ersten zwei Tage musst du was drauf haben! Du musst dich richtig vorbereiten. Ich habe da bestimmt zwei Monate für gearbeitet – ein bisschen, als ob du an einer Doktorarbeit schreibst. Da gehst du in die Bibliothek, suchst Filme, setzt das zusammen... Du musst eine Erzählung für dein Zeug haben. Du hast das Drehbuch, OK, das ist eine Blaupause. Aber wie es dazu gekommen ist – diesen Weg wieder zu rekapitulieren, und den Schauspielern mitzuteilen. Also: »Ich hab diese Szene geschrieben, weil ich mich an das erinnert habe...«‚ und »Kennt ihr das nicht auch?...« Und dann hast du die Situation, dass du nach zwei Tagen nicht mehr soviel reden musst, und dich ein bisschen zurücklehnen kannst.
Dieser Teil der Vorbereitung ist für mich auch eine Art Schauspielerei. Ich hab da auch Angst vor, Lampenfieber, weil das ja auch schief gehen kann. Man kann – wie ein Schauspieler – merken, dass es kein Publikum gibt. Oder dass die rausgehen, oder dass man dummes Zeug redet...
Hat sich diese Art der ersten Vorbereitung bei dir seitdem noch verändert?
Ich lade jetzt alle zum Lesen ein. Das schöne ist doch, dass auch die Leute, die nur eine Tagesrolle haben, alle gerne kommen. Es kommt den Schauspielern ja erst mal gar nicht auf die Gagen an – die sind ja normalerweise auch hoch genug.
Wobei ja nur für den Drehtag selber gezahlt wird - nicht für die Vorbereitung.
Es gibt bestimmt ein paar furchtbare Schauspieler, die kein Interesse an einer Vorbereitung haben, aber die kenne ich auch gar nicht, das ist eine Parallelwelt... Den meisten macht das im Gegenteil total Spaß! Vielleicht ein bisschen wie Boateng, der wahrscheinlich 5 oder 10 Mio. im Jahr verdient – der würde, glaube ich, wenn er hier durch Berlin geht und da einen Ball liegen sieht, und jemand fragt: »Hast du nicht Lust, 10min zu spielen?« – der würde das bestimmt machen. Das ist einfach eine Lust am Spiel...
Genau genommen ist diese gemeinsame Vorarbeit besonders für die Ein-Tages-Rollen wichtig, die ›supporting actors‹ – wenn die nicht vorher ein Ensemble-Gefühl haben, wenn die nur für den einen Tag gebucht, abends abgeholt und untergebracht werden, wo sie dann in der Einsamkeit des Hotels sitzen, dann morgens früh um sechs in Maske und Kostüm müssen, und dann Text abliefern – was soll daraus werden?!
Wir haben also diese erste Probenzeit, das ist jetzt bei meinem letzten Film zweieinhalb Monate vor Drehbeginn gewesen. Die Schauspieler spielen dann zwischendurch ganz andere Sachen. Aber wenn sie das Drehbuch wieder lesen – und das werden sie ja – dann lesen sie denselben Stoff ganz anders! Sie sehen sich nicht nur selbst, markieren nicht nur mit dem Edding ihre eigene Rolle – sondern sehen eine Situation. Weil sie da schon mal waren.
Bei meinem letzten Film sind wir eine Woche vor Drehbeginn mit einem richtigen Bus, mit mir als Reiseleiter, mit allen Schauspielern alle Motive abgefahren – das hatten die auch noch nie gemacht! Da kommt also so ein großer Reisebus, ich nehme ein Mikrofon, und dann fahren wir einen Tag zusammen herum. Zwischendurch steigen wir aus – wie so eine Gruppe, die Immobilien besichtigt. Die Motive sind ja inzwischen gebaut, bzw. ausgewählt, wenn es Naturmotive sind. Ich erzähle dann, was hier stattfinden wird, und warum ich das so gesucht habe. Und dann fahren wir weiter...
Das Tolle war, als wir beim ersten Motiv ausgestiegen und da herum gegangen sind, fingen alle sofort an miteinander zu sprechen! Und dann haben wir noch so ‚mood‘-Räume: Der Szenenbildner, Kade Grube, hat da seine gesamte Arbeit an Wände gehängt – wie so ein Museum, durch das die Schauspieler durchgehen können. Und da endet dann die Tour.
Wie organisierst du einen typischen Drehtag? Wird da auch noch geprobt?
Der idealtypische Drehtag ist so organisiert: Die Schauspieler dürfen nicht vor acht Uhr vom Hotel abgeholt werden. Die sollen ausgeschlafen sein – das sind Menschen mit Haut, mit Gefühlen, und ich mag diese überschminkten Gesichter nicht... Am Set ist dann nur die Regieassistentin, eine Aufnahmeleiterin und ich. Und die Garderobiere – die Schauspieler brauchen ihre Kostüme für die Proben, sonst ist es zu privat. Aber noch keine Maske.
Dann proben wir das ganze Tagwerk durch. Um zehn kommt der Kameramann, der Beleuchter, alle departments, der Ton, und wir zeigen eine Art Generalprobe, eine Ablaufprobe, wo aber noch nicht alles gegeben wird, was wir uns erarbeitet haben.
Dann verschwinden die Schauspieler in die Maske, haben meistens eineinhalb Stunden frei. Der Kameramann (Hans Fromm) und ich überlegen uns anhand der Probe, wie wir das auflösen. Es gibt eine Auflösung, die ich vorher überlegt habe, aber die ändert sich dann oft noch. Wir überlegen uns also, wie wir das filmen, und dann wird das mit einem Take gedreht – wenn‘s gut geht. Höchstens zwei. Das darf sich nicht verbrauchen...
Das heißt aber auch, man muss sich wirklich ziemlich klar sein vorher. Man kann dann nicht während des Drehs noch anfangen neu zu suchen...
Ich finde, nach dem Vorprogramm, was ich beschrieben habe, ist dann irgendwann auch das Ende erreicht. Dann muss ein Teil der Suche der Film selber sein. Sonst ist mir das dann zu abgehangen. Wenn ich dann noch weiter probiere – dann muss ich einen Bresson-Film machen. Aber dann würde ich auch ganz anders arbeiten. Interessiert mich aber nicht so. Ich versuche eher, so eine Art protestantischer Cassavetes zu sein...
Welche Rolle spielt für dich die Ausbildung eines Schauspielers?
Das sind ja normalerweise Theaterschulen. Und Theater ist nicht Kino – das ist ja ein kompletter Unterschied! Das muss man mal sagen – hallo, Otto-Falckenberg, hallo Ernst-Busch – was man dort lernt ist nicht geeignet fürs Kino. Überhaupt nicht.
Was man dort allerdings lernt ist Disziplin. Und das ist schon wichtig – für den Überlebenskampf der jungen Menschen. Weil die in der Branche behandelt werden wie ein Stück Scheiße! Weil sie nicht proben, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Weil sie wie Leiharbeiter behandelt werden: »Hier, kannst du mal eben die drei Schweinehälften zersägen mit deinem Elektromesser?«... Für gutes Geld, das schon, aber du nimmst nichts mit nach Hause. Das sind nur ganz wenige, die das Privileg haben, Rollen zu spielen, die sie erfüllen. Die einen Vorlauf haben – Proben haben.
Aber auf der Theaterbühne kann doch auch ‚wahrhaftig‘ gearbeitet werden...
Das ist eine andere Wahrhaftigkeit, eine komplett andere. Das Theater ist nicht unsere Gegenwart. Das ist Theatersprache, Choreographie, ist Tanz... Wir dagegen, die Schauspieler in unseren Filmen, die sitzen konkret in einem Raum, wie diesem Café hier, und der Raum hat Geschichte. Und die hat er nicht, weil er eine Bühne ist, sondern weil er ein realer Ort ist.
Um nochmal in den Begriffen des Theaters zu bleiben – improvisierst du mit den Schauspielern? Vielleicht auch ohne den Begriff selber zu benutzen?
Ich finde, alle gute Arbeit ist letzten Endes Improvisation. Wir schaffen einen geordneten, strukturierten Ablauf, um es mal so zu nennen, einen geschützten Raum, um darin die Möglichkeit zur Improvisation zu haben. Improvisation bedeutet aber nicht, keinen Text zu haben und stattdessen einfach zu sagen: »Jetzt macht mal irgendwas!« Sondern wir haben Text, wir haben Licht, wir haben Kostüm, Maske, und jetzt kommt es drauf an. Dieses wahnsinnige Ereignis, das das Kino hat, nämlich dass zwei Menschen einander gegenüber sitzen und blicken – kein anderes Medium kann Blicke erzählen, das Theater auch nicht! Und diese Blicke, wenn der Raum gesichert ist, wenn dieser Moment passiert, und die haben plötzlich einen Impuls, sich in die Augen zu schauen, oder die Augen zu senken – das ist für mich Improvisation. In Deutschland wird der Begriff ja eher genutzt für dieses auf-der-Bühne-rumlaufen und originell sein...
Hast du Techniken für Vorbereitung und Proben, über reines gemeinsames Textlesen und -sprechen hinaus? Recherche, szenische Dinge?
Ich habe da eigentlich keine ‚handwerklichen‘ Sachen. Oder doch – eine Technik habe ich: Und zwar erzähle ich vor jeder Szene, was vorher passiert ist, und was nachher passiert. Und zwar so, als ob das ein Film wäre! Ich stelle mich also nicht vor die Schauspieler und sage: »Weißt du noch, du hast doch gestern das und das gemacht...«, sondern etwa so: »Ein Mann geht die Treppe hoch. Er zögert. Das Licht im Treppenhaus geht aus. Er schaltet das Licht wieder an. Die Wohnungstür ist abgeschlossen. Er setzt sich auf die Stufen. Das Licht geht wieder aus. Diesmal steht er nicht auf, sondern bleibt im Dunkeln sitzen und hört auf die Geräusche.« So haben die Schauspieler ein Bild. Einen Film. Und das, was sie jetzt gleich machen, ist ein Teil dieses Films. Ich glaube, das hat Auswirkungen...
Es gibt ja lange Diskussionen über Schauspieltechniken 'von außen nach innen' oder 'innen nach außen'... Hast du dich damit mal beschäftigt? Interessiert dich das?
Das würde mich eher durcheinander bringen. Ich beschäftige mich mit Schauspiel, indem ich Filme anschaue und gucke, was die Schauspieler da so machen.
Machst du für deine Filme Castings?
Ich mache kein Casting. Ich gucke mir Filme an – da sehe ich genug.
Und bei besonderen Rollen-Paarungen?
Doch, da mache ich das. Aber da geht es dann nur darum, ob es auch zusammengeht. Bei Nina Hoss und Devid Striesow habe ich das gemacht. Und bei Julia Hummer und Bilge Bingül. Und bei Nina Hoss und Sven Pippig... Da hab ich es immer so gemacht, dass ich die nebeneinander an einen Tisch gesetzt habe, und sie mussten dann zusammen ein Musikstück hören. Das war‘s dann. Keine Szenen.
Das ist ja auch eine Art Improvisation.
Ja, ist es. Ich wollte wissen, wie lange es dauert, bis die zuhören. Ich habe dann beobachtet – das ist ja auch irgendwie peinlich, man schweigt drei Minuten – bis endlich die Luft rausgeht. Und irgendwann ändert sich etwas, die hören wirklich zu! Und dann geht die Musik wieder aus, der peinlichste Moment für alle, und dann spricht man ein bisschen drüber. Und dann weiß ich, ob wir miteinander reden können.
Es war dabei nie so, dass ich dann hinterher gesagt hätte: »Wir bleiben nicht zusammen.« Das Casting war eigentlich immer mehr eine Art Initiation. Und eben nicht, dass da draußen noch ein zweiter Kandidat gewartet hätte. Mir war vorher immer klar, dass die das spielen sollten... Ich wollte aber, dass sie das Gefühl bekommen, sie gehören zusammen! Diese Paare, die als Achse durch den Film führen, die müssen irgendwie zusammen gehören, das ist ganz wichtig.
Wie sieht es mit gemeinsamer Recherche aus?
Für die Vorbereitung von Barbara habe ich mit Ronald Zehrfeld und Nina Hoss einen Tag im Klinikum Neukölln organisiert. Wir konnten da einen Tag auf Visite mitgehen. Ronald und Nina sind dann hinter dem Tross her, mit weißen Kitteln, Kugelschreibern, und haben sich das alles angeguckt. Das war wichtig für den Film – dass die beide zusammen eine professionelle Erfahrung als Ärzte gemacht haben, dass sich beide achten – als Ärzte. Und die Liebe erst aus der Arbeit kommt.
Bleiben wir mal bei Barbara. Wie bereitest du eine konkrete Szene vor?
Ein ganz großer Fehler ist ja, dass man in den Proben etwas herstellt, was in sich stimmt, wie im Theater. Aber das Kino hat einen anderen Rhythmus. Weil es ja schneidet und montiert und blickt. Und das ist etwas, das man den Schauspielern beibringen muss: Ihr sollt nicht ›authentisch‹ sein! Ich finde, wir leiden unter diesem ›authentischen‹ Kino in Deutschland. Da wird eine Improvisationsszene gemacht, in der die Kamera einfach nur das filmt, was auch ohne die Kamera stattgefunden hätte...
Dagegen guckst du dir zum Beispiel von Ettore Scola, der ja vor vier Wochen gestorben ist, Ein besonderer Tag (Una giornata particolare) an: Marcello Mastroianni und Sophia Loren an einem Nachmittag in einer Wohnung – da gibt es Nahaufnahmen von ihrer Hand, die seine Hand nimmt und sich auf die Brust legt. Dann gibt es eine Aufnahme von ihrem Nacken, dann von seinem Nacken, während er am Fenster steht und raucht... Das heißt also, die Einstellungen erzählen selbst. Nicht die Schauspieler erzählen. Aber das musst du den Schauspielern erklären. Du musst ihnen erklären, wie du dir die Szene vorstellst. Du musst ihnen erklären, sie sind nicht in einem Raum, der nur ihnen gehört, sondern es gibt noch einen Raum darüber hinaus – einen filmischen Raum – Teile, Fetzen, Vorstellungen, Imaginationen. Der eine, der sich abwendet, stellt sich den anderen abgewendet vor – das finde ich ganz toll.
Ein anderes Beispiel: abgefilmter Sex – das ist das langweiligste, was es überhaupt gibt auf der Welt! Oder abgefilmte Küsse. Aber warum gibt es eine ganze Kultur, wie man Küsse filmt? Wie man Begehren, wie man Blicke filmt, montiert, zusammenbringt? Weil es ja grausam obszön und langweilig ist, einfach nur einen Kuss zu haben, der einem nichts erzählt. Wie kann man das also zeigen – die Berührungsängste, die Angst vor der Trennung, während man noch nicht einmal zusammen ist... Das kann man ja nicht einfach abfilmen. Das sind ja Gefühle! Deswegen ist das Kino ja auch allen anderen Künsten überlegen, weil es diese Gefühle nicht nur darstellt, sondern diese Gefühle sogar erzeugt!
Und ich finde, es gehört dazu, das den Schauspielern mitzuteilen. Wenn man aber Schauspieler nur benutzt, so in der Art: »Wir machen jetzt eine Szene, also zwei Jugendliche, kommt mal rein, die quatschen jetzt hier im Auto, wir filmen das mit und hinterher montieren wir das schon...«. Diese Arbeitsteilung finde ich furchtbar.
Wenn du mit Schauspielern über Szenen sprichst, arbeitest du dann auch mit Begriffen wie Ziel, Bedürfnis, Subtext? Als Beispiel vielleicht die Szene aus Barbara, in der sie von Andre nach Hause gefahren wird, und von ihm ermahnt wird, sich nicht so sehr zu ‚separieren‘...
Das war ja so: Bevor wir die Szene drehen konnten, musste erst mal das Auto präpariert werden. Wir steigen solange in einen anderen Wagen, fahren eine Stunde durch den Wald. Wir reden über das Autofahren in der DDR und solche Sachen. Und dann, irgendwann, fangen wir an, während der Fahrt den Text zu probieren. In dieser Szene ist ja eigentlich alles klar – du musst ja nicht auf den Subtext hinweisen. Meistens fahren wir dann irgendwann rechts ran, ich rauche eine und denke nach... In dieser Szene ist mir während dieser Fahrt erst richtig klar geworden, was das für eine bourgeoise, dünkelhafte Frau ist, die Barbara. Und zwar erst dadurch, wie Nina das gespielt hat! Und was das für ein proletarischer Mann ist, der sich von dieser blonden Frau so beeindrucken lässt...
Dann habe ich ihnen von King Kong und der weißen Frau erzählt. Dieses Bild, das es gibt, von blonden weißen Frauen aus den Großstädten, und den Männern aus der Provinz. Die da jetzt im Auto nebeneinander sitzen, und im Grunde voneinander beeindruckt sind, das aber einander nicht zeigen wollen. In diesem Fall ist Barbara natürlich stärker, wenn sie sagt: »Hah, du hast ‚separieren‘ gesagt! Du willst so sein wie ich.«
Da habt ihr dann vor Ort drüber gesprochen?
Ja, aber erst, nachdem sie das probiert hatten! So klar ist mir das selbst nicht gewesen, als ich es geschrieben habe.
Und dann gibt es ja auch noch den anderen Fall, dass ich dann plötzlich Angst kriege, dass das einfach eine ganz tote Szene ist. Und dann muss ich nachdenken: Warum ist die denn tot, woran liegt das? Dann bekomme ich auch Panik, muss mich erst mal zurückziehen... Meistens findet sich dann doch eine Lösung. Da muss man sich den Schauspielern auch anvertrauen können, sagen: »Die Szene ist tot, woran liegt denn das?« Und die haben dann eigene Vorschläge...
In dem Fall hat dieses Bild für mich auch das körperliche Verhältnis von Barbara und Andre für den ganzen Film klar gemacht: ganz nah im Auto nebeneinander – und dann später wieder, auf dem Weg zu ihrem ersten Kuss. Dazwischen liegen ein paar Tage, dieselbe Strecke, dasselbe Auto – hier ihre Dünkelhaftigkeit, da schmilzt sie dahin. Das hat dann auch für die anderen funktioniert – die Schauspieler hatten dann wirklich das Gefühl, in einem aufgeladenen Raum zu sein, und nicht mehr in einer Kulisse. Aber so konkret wurde das eben erst, als wir da morgens zusammen im Auto waren.
Wie sieht eine klassische Leseprobe aus bei dir?
Ich sitze da und mache die Augen zu, gucke die Schauspieler gar nicht an, höre mir nur die Stimmen an, den Klang, den Rhythmus, und mache mir so kleine Notizen: Ob der Rhythmus stimmt – ach nee, den Satz braucht man ja gar nicht... Im Grunde wie eine Partitur, die ich geschrieben habe, und dann ist ein Orchester da.
Die Schauspieler sind dann Profis genug, dass sie von sich aus einander zuhören, und sich in so einer Leseprobe schon berühren lassen?
In der Leseprobe nicht, nein. Da sage ich denen direkt: »Bitte keine Gefühle! So kalt wie es nur geht!« Aber die Stimmen sind ja verschieden, schon ohne ›Ausdruck‹, allein durch das, was sie biologisch mitbringen. Und ich höre zum ersten Mal die Texte, wie aus dem Kassettenrekorder. So habe ich da noch eine Distanz, und kann zum Beispiel sagen: »Rhythmisch stimmt das nicht, da sind zu viele Fragen...« etc. Und dann muss ich schauen, ob diese Sätze, die man manchmal einfach auch braucht – du weißt ja, »Ich bin seit gestern erst wieder in Berlin, und ich habe vergessen dich anzurufen...« – diese Sätze sind wichtig, aber klingen die? Stimmen die so? Deswegen mache ich die Leseprobe auch zwei Wochen vorher, damit ich das Drehbuch nochmal ändern kann.
Diese Leseproben – das passiert alles am Tisch? Oder steht ihr zwischendrin auch mal auf und spielt?
Nein. Das habe ich nur einmal gemacht, und zwar bei Die innere Sicherheit – da haben wir ein paar Stühle hingestellt, um die Autosituation zu simulieren. Das war dann einer der schönsten Momente – da haben wir uns für alle Zeiten befreundet, weil wir alle vier im selben Moment so lachen mussten! Weil es plötzlich aussah, als ob wir im Kinderladen wären... Dann haben wir uns wieder an den Tisch gesetzt.
Christian, danke für das Gespräch!
Christian Petzold ist Filmregisseur und Drehbuchautor. Er studierte von 1988 bis 1994 an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb). Seit 1995 schreibt und dreht er regelmäßig eigene Stoffe für das Kino, meist zusammen mit der Berliner Produktionsfirma Schramm Film Koerner&Weber. Für seinen Film Die innere Sicherheit (2000) wurde er mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet. Weitere erfolgreiche Kinofilme der letzten Jahre sind Wolfsburg (2003), Gespenster (2005), Yella (2007), Jerichow (2008), Barbara (2012), Phoenix (2014) und Transit (2018).